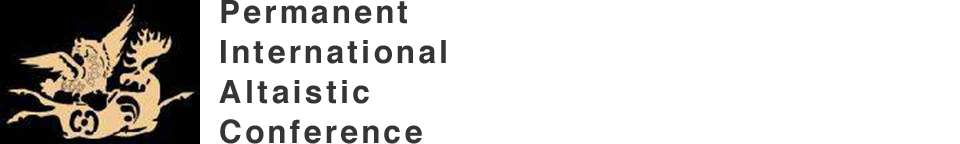Source: Michael Knüppel: Die 65. Jahrestagung der Permanent International Altaistic Conference (PIAC) in Astana. In: Journal of Oriental and African Studies, vol. 32, 2023, Athens, pp. 258–265.
Die 65. Jahrestagung der Permanent International Altaistic Conference (PIAC) in Astana
von Michael Knüppel
Vom 30. Juli bis 4. August 2023 wurde im kasachischen Astana die 65. Jahrestagung der Permanent International Altaistic Conference (PIAC) ausgerichtet. Gastgeber war die School of Sciences and Humanities der Nazarbayev University. Eröffnet wurde die Jahrestagung am 30. Juli vom Präsidenten der 65. Jahrestagung, Prof. Dr. Uli Schamiloglu. Gefolgt wurde die Eröffnungsansprache des Präsidenten von einer solchen des Präsidenten der International Turkic Academy, Shahin Mustafayev, der Acting Provost of Nazarbayev University, Loretta O’Donnell, des Acting Dean der School of Sciences and Humanities der Nazarbayev University, Anton Desiatnikov, des Präsidenten der 36. Jahrestagung der PIAC (in Almaty), Yerden Kazhybek, und des Generalsekretärs der PIAC, Oliver Corff. Im Anschluß hieran wurden die PIAC-Medaille (vormals „Indiana University Prize for Altaic Studies“) verliehen – die diesjährige Preisträgerin ist Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele – und die „Confessions“, d.h. die Berichte über die abgeschlossenen, laufenden und künftigen Arbeiten der Teilnehmer, abgehalten.
Den Kreis der eigentlichen Vorträge eröffnete, stellvertretend für den Präsidenten der International Turkic Academy, Napil Bazylhan, mit seinem Beitrag „The results of joint archaeological expeditions of ‘Nomgon-2019’ and ‘Nomgon-2022’“, welcher dem 1. Panel vorangestellt war. In dem Vortrag selbst berichtete der Referent von den Ergebnissen der Grabungs-Kampagnen und stellte hierbei zum ersten Mal öffentlich auch verschiedene der „runen“-türkischen Inschriften auf einigen der aufgefundenen Monumente vor. Insgesamt dürfte aus den entdeckten Schriftzeugnissen eine erneute Bereicherung des „runen“-türkischen Corpus resultieren, wenn man bedenkt, daß an den Grabungsplätzen bei weitem noch nicht alles zutage gefördert wurde.
Der erste Vortrag des 1. Panels, „Cultural history of Inner Asia“, „Ilteris Kutlug Kagan – in written sources“, wurde von Gulzhamal Dzhamankulova (Zhusup Balasagun Kyrgyz National University) gehalten. In dem Beitrag wandte sich die Referentin der Darstellung Ilteris Kutlug Kagans in den „runen“-türkischen Schriftzeugnissen zu, wobei sie sich vor allem mit den verschiedenen erzählerischen Mitteln, die die historischen Ereignisse beschreiben, auseinandersetzte. Gefolgt wurde dieser Vortrag von jenem Ma Xiaolins (Nankai University) „Chinese sources on the Mongol shamans in the Yuan court“, in welchem sich der Referent mit den schamanischen Ritualen am Hofe der Yuán-Kaiser beschäftigte. Es handelte sich hierbei, wie der Beiträger zu Recht anmerkte, um einen Gegenstand, dem bislang zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde, was wohl dem Umstand geschuldet sein dürfte, daß die bestehenden Quellen nahezu allesamt in chinesischer Sprache abgefaßt sind. Im Vortrag wurden einige bis jetzt nicht beachtete Dokumente resp. Angaben aus solchen zu Trance, Feueranbetung, Opfer, Mantik etc. behandelt und die Angaben anhand mongolischer und persischer Quellen betrachtet. An diesen Beitrag anschließend trug Qiu Zhirong (Renmin University of China) über „Migration and identity: An Ölberli family in China in the 3-4 centuries“ vor. Hierbei wurde die bisherige Forschung zum Namen Ölberli nachgezeichnet und betont, daß die jeweiligen Autoren einer für den Gegenstand bedeutsamen chinesischen Quelle – der Inschrift einer Ölberli-Familie aus dem 14. Jh. – bislang keine Aufmerksamkeit hatten zuteil werden lassen und behandelte ausführlich den Wanderweg dieser Familie von Zentralasien nach Süd-China während der Yuán-Zeit, unter Berücksichtigung ihrer ethnischen, religiösen und kulturellen Identität. In dem das Panel beschließenden Vortrag von Alice Crowther (École pratique des Hautes Études, Paris), „The atlas of the Mukden hunting grounds (Shengjing weichang quantu 盛京圍场全圖) in the Chinese collections of the Collège de France“, stellte die Referentin eine Sammlung von 104 handgezeichneten Karten eben jener Jagdgründe, die wohl um 1839 entstanden sind, vor und stellte dieses Material in einen kulturhistorischen Zusammenhang sowie zur heutigen topographischen Situation.
Das 2. Panel, „The lost heritage“, wurde mit dem Vortrag von Ákos Bertalan Apatóczky (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary) „Forgotten manuscripts and other Sino-Barbarica from Louis Ligeti’s unpublished works“ eröffnet. In dem Beitrag berichtete der Referent über die „Sino-Barbarica“ in dem sich heute in den Beständen der Ungarischen Akademie der Wissenschaften befindlichen Nachlaß L. Ligetis, der seit 2018 von einer Expertenkommission, der der Vortragende selbst angehört, erschlossen wird. Hierbei stellte der Referent die Materialien (– sowohl die Gruppen, zu denen sich diese inhaltlich zusammenfassen lassen, als auch einzelne Stücke –) vor und lieferte Angaben zu Umfang, Maßen, Charakter, Jahren, Orten etc. (sofern angegeben) und den Zusammenhängen mit anderen Bestandteilen des Nachlasses, freilich auch publizierten Arbeiten Ligetis. Hierauf folgte der Vortrag von Junko Miyawaki-Okada (Toyo Bunko) „Galdan Boshoqtu Khan’s mother was a Khoshuud, not a Torghuud“, in dem die Referentin anhand des erst 1983 in Xīnjiāng entdeckten Mongghol-un ugh eki-yin teüke auf die Herkunft der Mutter Galdans einging, wobei sie die verschiedenen Hypothesen hinsichtlich ihrer Abstammung vorstellte und sich schließlich – dem dPag-bsam IJon-bzang (1748) folgend – für die Annahme aussprach, daß diese die Tochter des Güüshi Khan der Khoshuud gewesen ist. Den letzten Beitrag des 2. Panels bildete der Vortrag von Hartmut Walravens (International ISMN Agency) „On the tracks of a lost book“, in dem zunächst auf die Bedeutung der Manǯu-Studien in Europa sowie für die Sinologie und Tungusologie eingegangen wurde, bevor der Referent sich dem verlorenen Manǯu-Wörterbuch H. J. (v.) Klaproths (1783-1835) zuwandte.
Das 3. Panel, „Sources and traditions“ wurde von Pierre Marsones (École Pratique des Hautes Études, Paris) Vortrag „The sacrifices of the Khitan and sacred mountains in Khitan culture. The Liaoshi as an exceptional documentary source on the culture of an Altaic people“ eingeleitet. In dem Beitrag ging der Verfasser vor allem auf das Liaoshi, das, obgleich es die üblichen schablonenhaften Charakterisierungen der „nördlichen Barbaren“ enthält, doch auch einige aufschlußreiche Angaben beinhaltet. Hinsichtlich der Religion der Khitan wiederum liefern einige Inschriften (etwa in buddhistischen Tempeln) Informationen, allerdings auch das Longkan shoujing. In ihrer Gesamtheit bieten diese Quellen immerhin hinreichend Material für die Schaffung eines Eindrucks von den kaiserlichen Ritualen der Khitan und den Orten, an denen diese durchgeführt wurden. Im anschließenden Beitrag referierte Saule Tazhibayeva (L. N. Gumilyov Eurasian National University) dann über „New sources for study of the Kazakhstani Turkish community“. Tatsächlich ging es hierbei um die meschetische Gemeinschaft in Kasachstān und deren Situation. Die Mescheten des Landes sind Nachfahren der aus dem transkaukasischen Gebiet 1944 nach Kasachstān deportierten Türken. Hierbei wurden von der Referentin die sprachliche Situation, die interethnischen Beziehungen, aber auch solche zur heutigen Türkei, deren Sprachpolitik in Kasachstān zur Gefährdung der meschetischen Varietät in Gestalt der Verdrängung durch das moderne Türkeitürkische beiträgt, behandelt. Hieran anschließend folgte der Beitrag von Michal Schwarz (Masaryk University), „Data collecting and analytic approaches towards the oral memory of the human landscape relations in the Mongolian Altai“, in welchem der Referent Ergebnisse seiner langjährigen Feldforschungen im Altaj-Gebiet (vor allen im Hinblick auf die Urjaŋchai) vorstellte. Die hier ebenfalls skizzierten gegenwärtigen Feldforschungen zielen einerseits darauf ab das Verhältnis zwischen Mensch, Tier und Landschaft in der identitätsbildenden mündlichen Überlieferung der Ethnien der Altaj-Region zu untersuchen und andererseits Forschungen hinsichtlich vergleichbarer Prozesse bei altajischen Völkern in entfernterer Vergangenheit anzuregen. Beschlossen wurde dieses 3. Panel mit dem Beitrag von Zsuzsanna Olach (Jagiellonian University), „New sources in Karaim language history: The Karaim Bible translations“, in dem die Referentin von den Fortschritten des Projekts zur Untersuchung der karaimischen Bibelübersetzungen berichtete. Ein besonderes Augenmerk richtete sie hierbei auf die Verwendung des Suffixes –(X)p, aber auch Auffälligkeiten der Lexik sowie vor allem auf die Abweichungen der verschiedenen karaimischen Übersetzungen der hebräischen Bibel, welche bedeutsam für das Verständnis der Glaubenswelt der Karaimen sind.
Im ersten Vortrag des 4. Panels, „Issues in interpreting Turkic languages“, referierte Ekaterina Grudzeva (University of Helsinki) über „Turkic languages of Russia: Current issues of taxonomy and vitality“ und präsentierte die Ergebnisse eines Projekts zu Anzahl und sozio-linguistischer Lage der Turksprache in Rußland, welche dort ein Fünftel der gesprochenen 155 Sprachen ausmachen. Hierbei wurden die Turksprachen in sieben Gruppen geordnet. Die Zusammenstellung orientierte sich dabei an linguistischen, ethnischen, demographischen und geographischen Kriterien. Ein Ziel des Projektes, welches hier vorgestellt wurde, war die Ermittlung des Grades der Bewahrung / Gefährdung der jeweiligen Sprachen. Im folgenden Beitrag, „The features of Turkic proverbs and its parallels in European languages“ ging Raushangul Mukusheva (Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University) dem poetischen Charakter einiger türkischer Spruchweisheiten / Sinnsprüche (aus dem Kasachischen, Kirgisischen, Türkischen, Tatarischen, Azerbaiǯanischen etc.) nach. Zudem behandelte die Referentin in ihrem Beitrag die möglichen türkischen Ursprünge einiger ungarischer Spruchweisheiten / Sinnsprüche, die teilweise durch andere europäische Sprachen vermittelt sind, mitunter aber auch direkt aus türkischen Sprachen entlehnt sein könnten, wobei auch die Vermittlerrolle des Bulgarischen sowie slavischer Sprachen erörtert wurde. Im letzten Vortrag des Panels sprach Murat Işık (Szeged University) über „The interpretation of infinitival paronomastic usage in Biblical Hebrew within Karaim Bible translations“. In den karaimischen Texten – hier bereits den frühesten Übersetzungen biblischer Texte ins Karaimische – findet sich eine morpho-syntaktische Bildung, die gemeinhin als „paranomastische Konstruktion“ bezeichnet wird. Bei dieser ist ein infinites Verb demselben finiten Verb vorangestellt. Hierfür hat es in der Vergangenheit verschiedene Erklärungsversuche hinsichtlich der möglichen Vorbilder gegeben – u.a. wurde hierfür ein slavischer Einfluß bemüht. Dieser jedoch kann aufgrund der Tatsache, daß sich entsprechende Konstruktionen bereits in den frühesten Übersetzungstexten finden, weithin ausgeschlossen werden. Vielmehr scheint hier, wie der Referent überzeugend darlegte, eine Lehnübersetzung (strenggenommen Lehnsyntax) vorzuliegen.
Im ersten Beitrag des 5. Panels, „Interpreting sources in Altaic languages“, referierte Erbol Munai (L. N. Gumilyov Eurasian National University) über „Lexical-semantic analysis of occupational names in Temür Qutlugh Khan’s yarlïğ. Es handelt sich bei den yarlïğs um offizielle Dokumente der Herrscher der Goldenen Horde, welche in mittel-qypčakischer Sprache abgefaßt wurden. Die Urkunden oder vielmehr deren Sprache, die hier einer genaueren Betrachtung unterzogen wurde(n), stammen aus der Kanzlei Temür Qutluġ Ḫāns und waren Ende des 14. Jahrhunderts an die Angehörigen der Giray-Dynastie gerichtet worden. Der Referent stellte in dem Vortrag vor allem seine Forschungen zur Semantik der Berufsbezeichnungen in diesen Dokumenten vor. Im anschließenden Beitrag von Liu Ge (Shaanxi Normal University), „A general survey of the conditional suffixes in 82 Uighur contracts“, ging die Referentin der Verwendung des verkürzten Konditional-Suffixes –sa, –sä, –za, –zä in uigurischen Dokumenten der Yuán-Zeit nach und unterzog die Annahme L. V. Clarks, daß diese Suffixe Aufschluß über das mögliche Alter der Urkunden geben könnten, einer kritischen Betrachtung. Nach Ansicht der Referentin, stellt Clarks Annahme eine recht einseitige Behandlung dar, da sich die verkürzten Konditional-Suffixe in denselben Dokumenten neben den nicht-verkürzten (-sar, –sär) finden, letztere häufiger in diesen Dokumenten vorkommen und die Texte der Dokumente zudem verschiedene Konditional-Suffixe enthalten. Über die zuvor untersuchten fünfzehn Dokumente hinaus wurden von der Referentin gelegentlich 82 weitere Manuskripte einer Musterung unterzogen und diese Arbeit sowie die Ergebnisse vorgestellt. Mit dem anschließenden Vortrag von Haruna Tanikawa (Waseda University), „Mongolian as a Lingua franca: Documents sent from Russia to Khalkha Mongolia during the Qing period in The Mongolian National Central Archives“, wurde das Panel beschlossen. In dem Beitrag wurde auf die Diplomatie nicht der Regierungen des Russischen Reichs und Chinas vom 17. bis zum frühen 20. Jahrhundert, sondern vielmehr auf die eher „lokale“ Ebene des Austauschs zwischen Vertretern des Zarenreichs in Sibirien mit mongolischen Würdenträgern eingegangen. Schriftliche Zeugnisse dieses Austauschs finden sich heute im Mongolischen Nationalen Zentralarchiv und zeigen, wie im Vortrag ausgeführt, daß das Medium dieses diplomatischen Verkehrs die Mongolische Sprache war und russische Urkunden und Briefe in der Regel von mongolischen Übersetzungen begleitet wurden. Im folgenden Beitrag stellte Kyoko Maezono (Jena University) das „Case Suffix -Ø in Mongolian and Manju“ vor. Hierbei wurde auf eine Gemeinsamkeit des Schriftmongolischen mit dem Manǯu, nämlich der Nicht-Markierung des Casus, anhand von Beispielen aus dem mongolischen, Erdeni-yin Tobči und dessen manǯurischer Übersetzung, eingegangen. Im letzten Beitrag des Panels behandelte Assyltas Kaltenova (L. N. Gumilov Eurasian National University) die „Contrastive analysis of food industry terms in Kazakh, English, and Russian languages on the basis of legislative documents“. In dem Vortrag wurden die Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung von mehr als 100 Termini aus dem Bereich der Nahrungsmittelherstellung, die in verschiedenen Dokumenten in den genannten Sprachen erscheinen, vorgestellt. Hierbei spielt, wie die Referentin darlegte, eine Rolle, daß es verschiedene Möglichkeiten der Übertragung der in Frage stehenden Terminologie gibt (direkte Entlehnung, indirekte Entlehnung), in welchen sich die historische Entwicklung der Kasachischen Sprache widerspiegelt (hier vor allem durch die Übertragung russischer Terminologie ins Kasachische, aber auch eine solche aus dem Englischen als Reflektion von Globalisierungsprozessen).
Das folgende 6. Panel, „Sources for Chinggisid history“, wurde mit dem Vortrag von Emma Usmanova (Buketov Karaganda University), „The mausoleum of Jochi Khan as legacy of the Sufi movement in Central Asia“ begonnen. In dem Beitrag wurden die Geschichte und die Bedeutung, aber auch die Besonderheiten des Mazars Jöčis, des Vorfahren der Ḫāne der Goldenen Horde, beleuchtet. Wie die Referentin betonte, scheint ein Widerspruch zwischen der muslimischen Architektur und der Religionszugehörigkeit des čiŋγisḫānidischen Abkömmlings, der in dem Bauwerk begraben wurde, zu bestehen. Aufgrund der Ähnlichkeit der Anlage mit anderen Mausoleen Turkestāns ist hier das Vorliegen einer Vermengung vor-islamischer und islamischer Rituale zu vermuten. Im folgenden Beitrag, „Contextualizing the Yarlıqs from the Golden Horde and the Later Golden Horde“, behandelte Uli Schamiloglu (Nazarbayev University) die als Yarlıqs bezeichneten Urkunden der Goldenen Horde (13.-14. Jh.) und der sogenannten „späten“ Goldenen Horde (15.-18. Jh.). Wie vom Verfasser ausgeführt, haben diese Dokumente schon seit J. v. Hammer-Purgstall immer wieder das Interesse der Turkologen gefunden. Im Vortrag ging U. Schamiloglu vor allem der Frage der Verwendung von verschiedenen Titeln und Termini im Laufe der Jahrhunderte und deren sich wandelnden Kontexten aus sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher, aber auch aus politischer Perspektive ein. Im folgenden Vortrag von Sándor Papp (Szeged University), „Sources to the eastern diplomacy of the Ottoman Empire (15th-17th centuries)“, galt das Interesse dann der Sprache der Diplomatie des Osmanischen Reichs mit den territorialen Herrschaftsverbänden „des Ostens“. Ausgehend von dem Umstand, daß die Sprache der Diplomatie in Zentralasien ein türkisches Idiom war und diese Tradition eben auch mit dem Osmanischen Reich geteilt wurde, ging der Referent den Konventionen des diplomatischen Verkehrs der Osmanen anhand von osmanischen, persischen und türkischen „Aktenstücken“ in bislang unveröffentlichten Sammlungen in Archiven in Istanbul, Wien und Taschkent nach. Hieran anschließend wandte sich Barbara Kellner-Heinkele (Freie Universität Berlin) der „Steppe diplomacy: The Kazakh Lesser Horde and its neighbours in the mid-18th century“ zu. Seit der Unabhängigkeit Kasachstāns wurden, wie die Referentin betonte, zahlreiche Arbeiten zur Geschichte des Landes herausgebracht, unter diesen auch Werke, die sich mit den traditionellen Reichsbildungen befaßten. Die Historiker haben inzwischen zahlreiche Quellen erschlossen und ausgewertet. Die Vortragende stellte nun zwei Briefe des Ḫāns der Kleinen Horde, Nur Ali, welche dieser im Jahre 1755 an Zarin Elisaveta gerichtet hat, vor. Diese waren den Historikern entgangen, da sie sich im Archiv für Außenpolitik des Russischen Reiches (AVPRI) falsch zugeordnet fanden. Die beiden Manuskripte wurden von der Referentin ausführlich beschrieben und in ihren historischen Kontext gestellt.
Das folgende 7. Panel, „Sources for traditional Altaic religions“, wurde von Michael Knüppel (Arctic Studies Center (ASC), Liaocheng University) mit dem Vortrag „Dæmonologia Tuvinica – names and concepts of ‘intermediary beings’ in Tyvan language and culture“ eröffnet. In dem Beitrag behandelte der Verfasser zwei Gegenstände hinsichtlich der tuwinischen Namen von Gottheiten, Geistern und mythischen Wesen. Einerseits den Sammelbegriff der „Zwischenwesen“ und die Übertragung dieses Konzepts auf die tuwinischen Verhältnisse und andererseits das Problem der Klassifizierung dieser Zwischenwesen bei den Tuwinern im Kontext der Klassifizierungen / Kategorisierungen von Zwischenwesen bei den altajischen Völkern (hier vor allem der frühen Türken, aber auch der Tungusen) und des auch bei den Tuwinern verbreiteten „nördlichen“ Buddhismus. Beschlossen wurde dieses Panel mit dem Vortrag von Dávid Somfai Kara (Nazarbayev University), „The Majmūcat ul-tawārih. A Sūfi chronicle from the Farghāna Valley and the Kirghiz epic tradition“, in dem auf ein persisches Manuskript aus dem 16. Jahrhundert, in welchem sich eine Vermischung von vor-islamischer, turko-mongolischer Tradition mit Anschauungen der Sūfis zeigt, eingegangen wurde. Dieses Schriftdenkmal stellt ein Zeugnis aus der Zeit der Islamisierung der steppennomadischen Bevölkerung durch die Vertreter der Sūfis, die Xwājas, die hier den Kampf der muslimischen Kirgisen in der epischen Tradition des Manas gegen die „ungläubigen“ Kalmücken als „heiligen Krieg“ beschreiben, um die Angehörigen der Stämme für ihr Wirken resp. den Islam zu gewinnen, dar.
Mit dem Beitrag „Amuric – a new source for Altaic studies“ von Juha Janhunen (University of Helsinki) wurde das achte und letzte Panel, „New sources for Altaic studies“ aufgenommen. In dem Vortrag stellte der Referent vor, wie sich anhand des „intern“ re-konstruierten Amurischen, dessen verbliebene Glieder, die Varietäten des Nivchischen, darstellen, Erscheinungen in den sogenannten „altajischen“ Sprachen erklären lassen. Das Amurische, welches auch die dominierende Sprache in der südlichen Manǯurei, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Reich von Puyŏ (Buyeo), gewesen sein könnte, dürfte in lexikalischer wie auch in struktureller Hinsicht sowohl Geber- als auch Nehmersprache in den Sprachbeziehungen mit den altajischen Sprachen gewesen sein. Für die Stützung der Annahmen wurden von J. Janhunen verschiedene Beispiele gegeben. Auf diesen Beitrag folgte der Vortrag von Sami Honkasalo (University of Helsinki) und Chingduang Yurayong (University of Helsinki) „Quantification of verbal event: A new perspective for studying convergence and divergence across Altaic languages“, in dem die Referenten die Ergebnisse ihrer Untersuchung der Verteilung und Umsetzungen der Markierung der Zählung von Ereignissen im altajischen Verbalsystem anhand der Befunde aus rund 40 altajischen Sprachen sowie vierhundert weiteren Sprachen des östlichen Eurasien vorgestellt haben. Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, nach denen sich diese Markierungen der Quantifizierung typologisch klassifizieren lassen: (1.) die Unterscheidung, ob eine Sprache ein Klassifizierungssystem zur Zählung von Entitäten (Substantivklassifizierer) und Vorkommnissen (Verbalklassifizierer) hat, und (2.) die morphosyntaktische Realisierung der beiden verbleibenden Strategien der Ereigniszählung: gezählte Substantive und Iterative. Im folgenden Beitrag trug Julie Lefort (Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale (CRLAO), Paris) über „Turkic vocabulary in Dongxiang Mongolian: a possible substrate?“ vor. Im Dongxiang-Mongolischen, dessen Genese nicht unumstritten ist und für welches gar ein türkischer Ursprung angenommen wurde, finden sich tatsächlich einige türkische Wörter, die die Referentin einer genaueren Musterung unterzogen hat. Sie scheidet diese in (1.) gemein-türkisch-mongolisches Vokabular und frühe türkische Entlehnungen im Mittel-Mongolischen, (2.) regionales Vokabular, bei dem es sich um sekundäre türkische Entlehnungen handelt und (3.) Wörter, die ausschließlich im Dongxiang-Mongolischen vorkommen und keine Entsprechungen in anderen türkischen Sprachen haben. Bei den letzteren dürfte es sich wohl, wie von der Referentin dargelegt, um ein Substrat handeln. An den Vortrag anschließend referierte Ding Shiqing (Minzu University) über „The conservation of Altai language resources in China: Current situation and problems“, wobei ein Projekt zum Schutz der Sprachressourcen der Sprachen und Dialekte Chinas vorgestellt wurde. Das Projekt hatte in seiner ersten Phase (von 2015-2019) zunächst eine Datenerhebung, deren Auswertung nun in der gegenwärtig laufenden zweiten Phase erfolgt, zum Gegenstand. Im Vortrag wurden allgemeine Charakteristika, bestehende Schwierigkeiten und Ausblicke auf die Zukunft hinsichtlich der in dem Projekt mitbehandelten altajischen Sprachen umrissen. Beschlossen wurde das Panel und damit die Folge von Vorträgen der Jahrestagung mit dem Beitrag „Defining the new normal: Transformations of lexicon and grammar in two Manju dictionaries“ von Oliver Corff (PIAC), in welchem der Referent die verschiedenen Techniken der Überarbeitung des Manǯu-Wörterbuchs Han-i araha Manju gisun-i nonggime toktobuha buleku bithe (gedruckt 1772) gegenüber dem ersten Manǯu-Wörterbuch, dem Han-i araha Manju gisun-i buleku bithe (gedruckt 1708), vorstellte. Wie im Vortrag dargestellt, kommen sechs verschiedene Möglichkeiten, die allesamt umrissen wurden, in Frage und finden sich tatsächlich auch beim Vergleich der Lemmata in den beiden Fassungen des Wörterbuchs.
Begleitet wurde die Jahrestagung von verschiedenen Aktivitäten am Rande, wie dem Besuch des Dokumentationszentrums von Alzhir, des Nationalmuseums, der Hazret Sultan-Moschee, einer Stadtrundfahrt sowie einer Führung über den Campus der Nazarbayev University.
Diese 65. Jahrestagung, an der Beiträger aus rund einem Dutzend Länder teilgenommen haben und welche hervorragend organisiert war, kann sowohl hinsichtlich der Durchführung als auch der Qualität der Vorträge als ein bemerkenswerter Erfolg betrachtet werden und alle Teilnehmer und Interessenten dürften der auf der Jahrestagung bereits angekündigten kommenden Konferenz im Juni 2024 in Göttingen mit großen Erwartungen entgegensehen.
Michael Knüppel